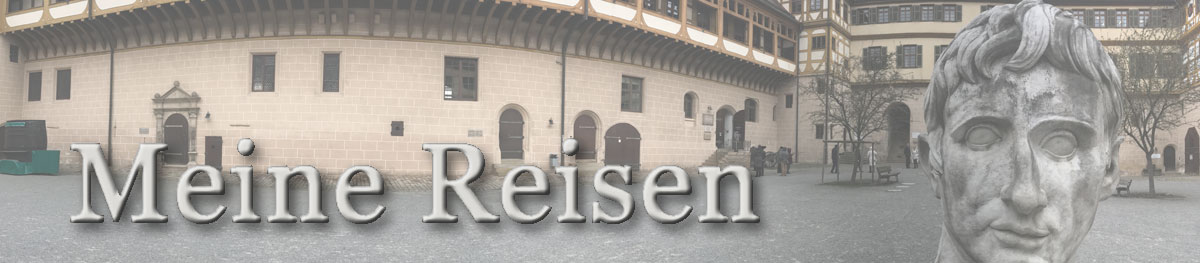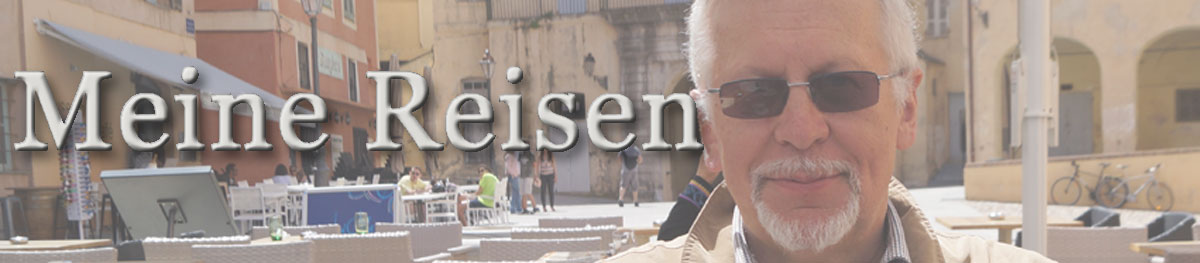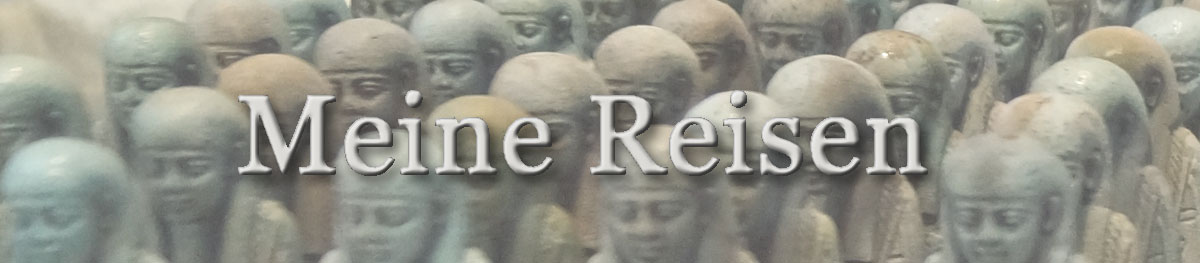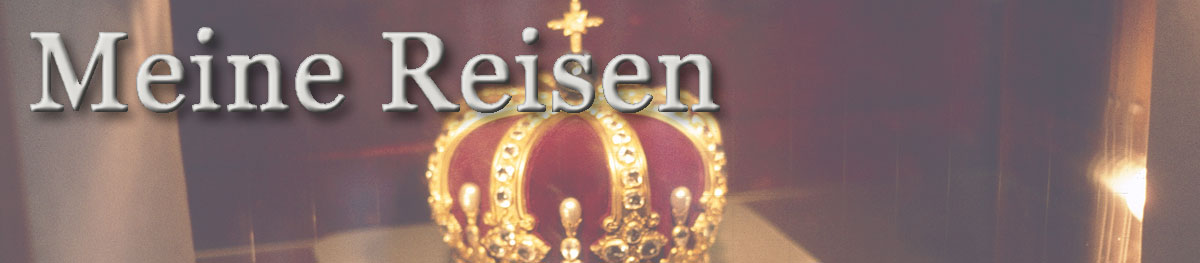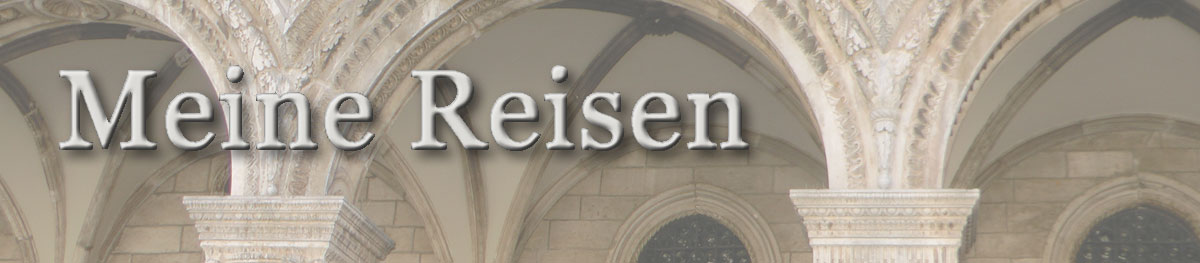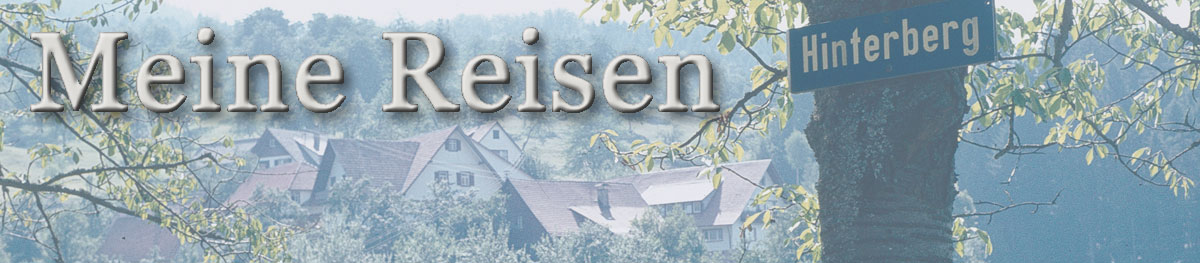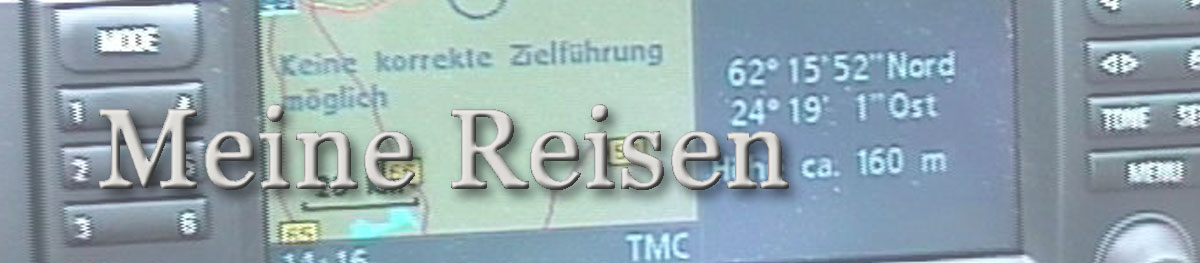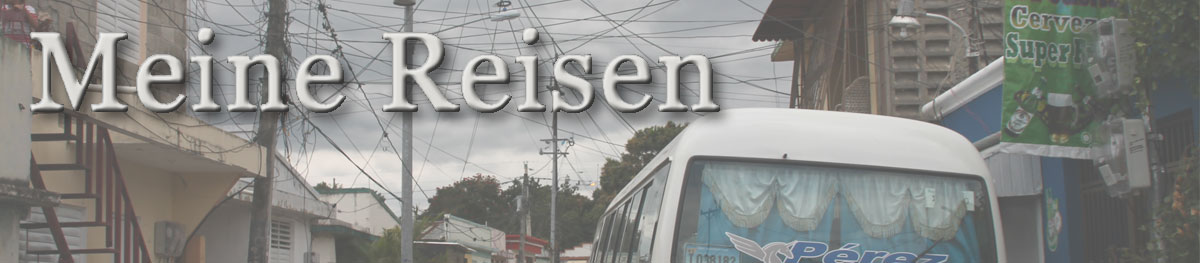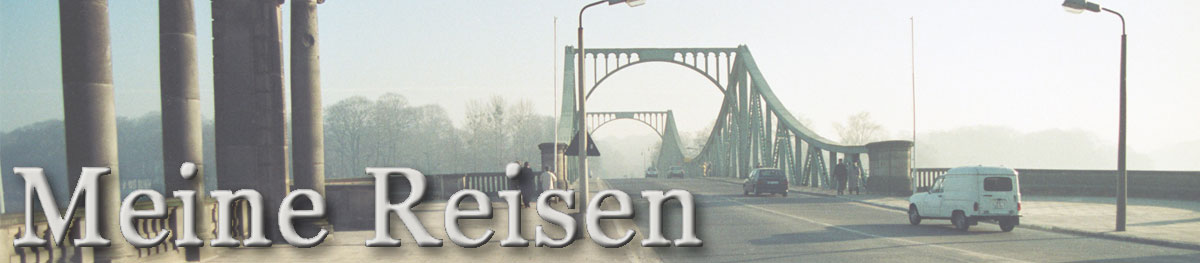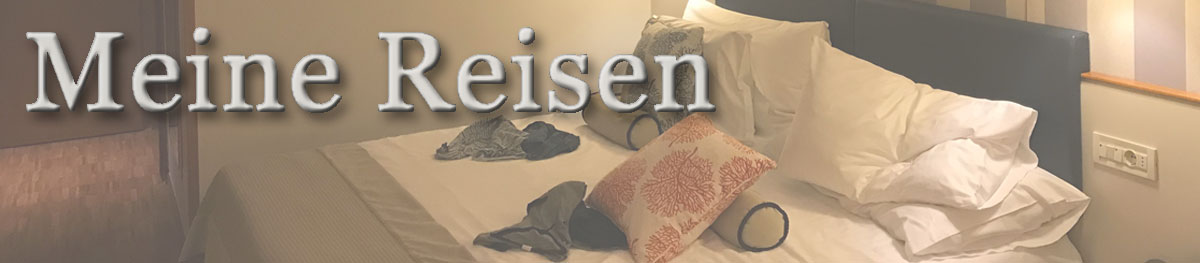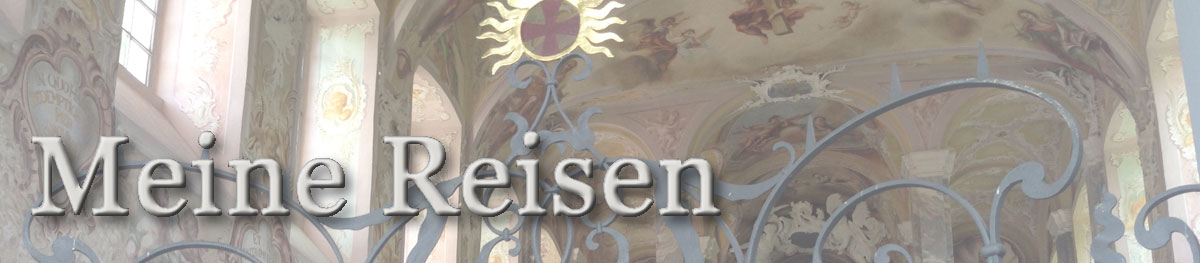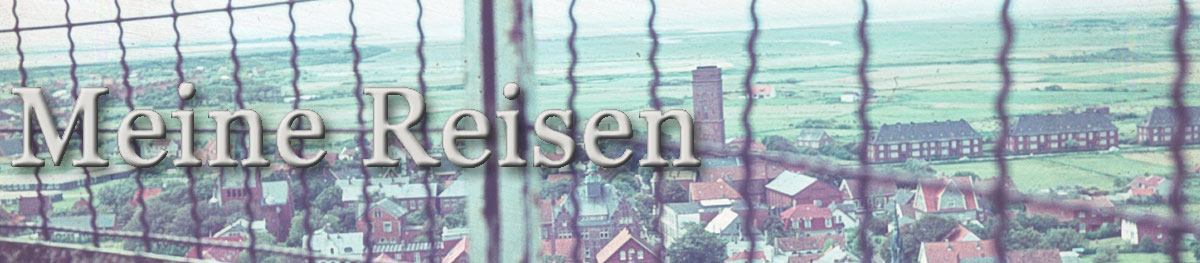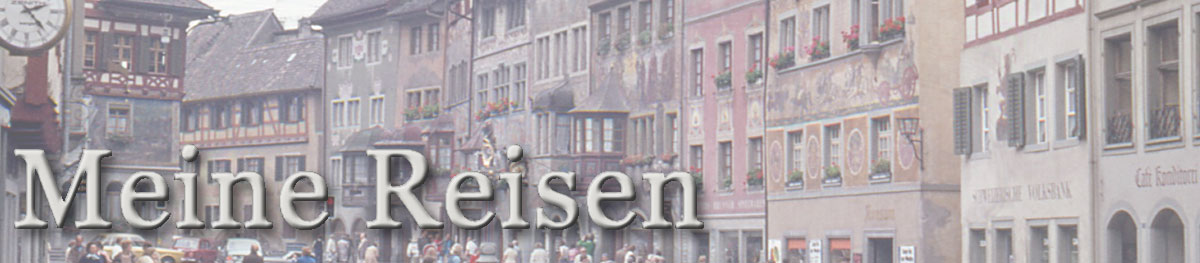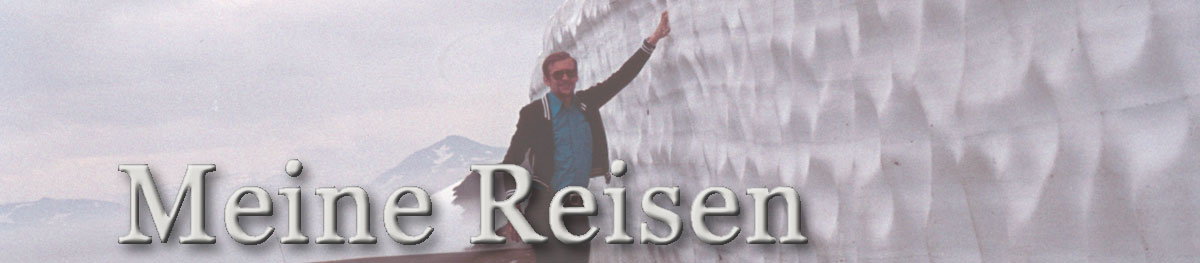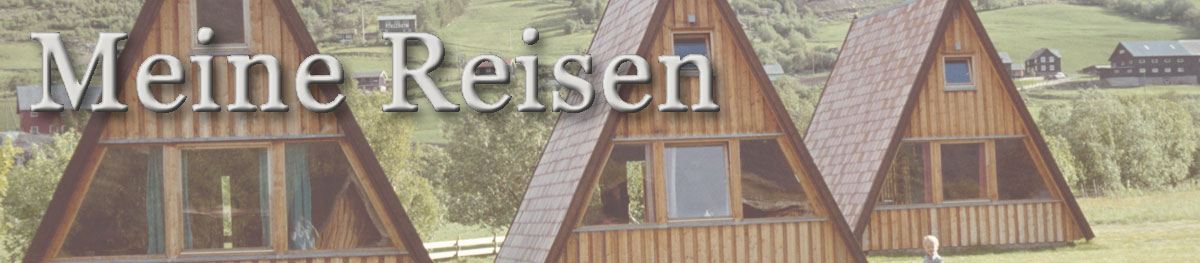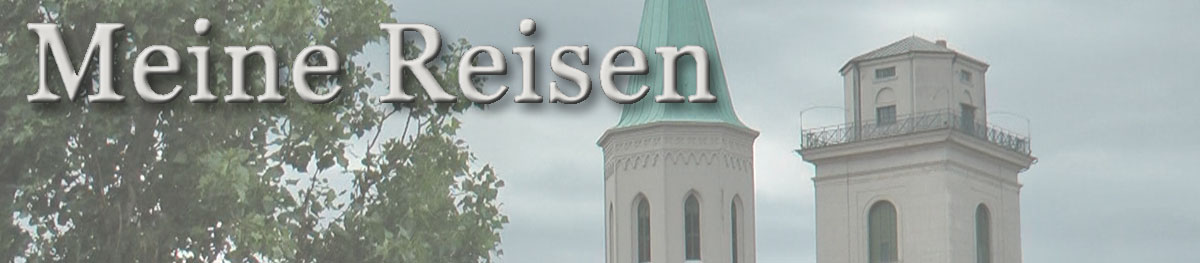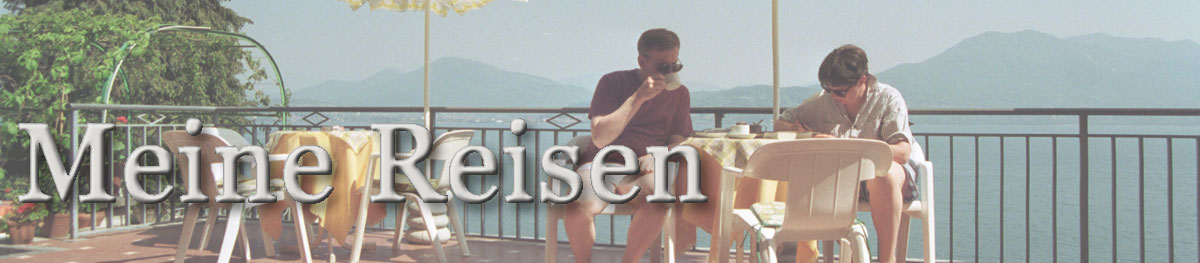Mittwoch, den 2. Juli 2025
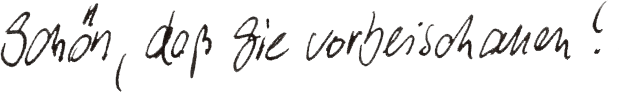
Das Internet hat seit seiner Erfindung und Verbreitung eine rasante Entwicklung hingelegt. Vergleiche mit Erfindungen wie dem Rad, dem Buchdruck, der Elektrizität sind nicht übertrieben. Fast alles, was die Menschen auf der Erde bewegt, steht heute auf irgendeiner Seite, die adressiert werden kann. 1,9 Milliarden sollten es Ende 2021 sein (Auch das findet man recht schnell im Netz!). Allerdings müssen beim Internet zwei Erfindungen mitgedacht werde, ohne die es so nicht nutzbar wäre: der Computer und die Suchmaschine.
Willkommen
Wie funktioniert das Internet eigentlich? Wie können rund 5 Milliarden Nutzer Seiten aus 1,9 Milliarden Angeboten auf der ganzen Welt abrufen? Ist es möglich, selbst Informationen auf einer eigenen Seite anzubieten?
auf meinen
Das hat mich früh interessiert, nachdem ich mich mit den ersten "Homecomputern" und Programmiersprachen beschäftigt hatte. Doch auch die Hard- und Software entwickelten sich rasant weiter. Und die alten, handgeschriebenen HTM-Seiten sind längst komplexen Systemen gewichen.
Seiten!
Aus all diesen Gründen gibt es diese Seite.
Hier gibt es viel auszuprobieren, es macht Spaß Informationen zu präsentieren und man lernt bei Reisen in die digitale Welt nicht nur Neues, sondern auch Disziplin! Und wenn ich nun die dabei erworbenen Kenntnisse und Fähigkeiten ehrenamtlich sinnvoll einbringen kann, umso besser!
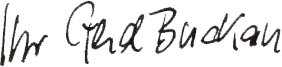
| © gerd-buckan.de - Verwendung von Bildern und Text nur mit Genehmigung! | ||
Wenn du weit und schnell reisen möchtest, reise mit wenig. Befreie dich von deinem Neid, deiner Eifersucht, deiner Unversöhnlichkeit, deiner Selbstsucht und deinen Ängsten. Cesare Pavese | ||
 |  |  |
| "Der Bezirk "Nord-Pas-de-Calais" liegt im Norden Frankreichs, an der Grenze zu Belgien. Beiderseits der Grenze liegt Flanden, und Lille nennt sich "die Hauptstadt von Flandern" | Ein Besuch - Essen liegt ja gar nicht so weit weg von Köln - lohnt sich definitiv! Viele verbinden das Ruhrgebiet nur mit Kohle und Stahl, hier aber zeigt sich die Industrie, zeigt sich speziell die Familie Krupp von einer anderen, privaten Seite. Gleichzeitig lernt man das "grüne" Ruhrgebiet kennen. | "Insel der Wichte" hieße es auf deutsch, und es gibt noch andere etwas schrullige Dinge auf dieser kleinen Kanalinsel nahe Portsmouth. Andererseits ist sie so typisch englisch und von schöner landschaftlicher Natur, dass ich froh bin, dort gewesen zu sein! |
 |  |  |
| Von Dresden über Riesa nach Strehla, dann zur hochwasser-gebeutelten Stadt Mühlberg, wegen der sich die Städte im 6-Städte-Bund eine blutige Nase holten, über Belgern nach Wittenberg (Luther!). Und früher gabs Wasserstands-meldungen im Radio: " ... die Elbe bei Torgau ...", auch ein schönes Ziel. | In einem "Gutshof" Urlaub zu machen, ist etwas besonderes. Das Gut Lobendorf liegt bei Vetschau/Spreewald mitten in einem Waldgebiet und hat zwei schöne Ferienwohnungen eingerichtet. Sehr großzügig! Und die Brötchen werden morgens auf Wunsch gebracht ... | Die Insel Norderney gehört zum Landkreis Aurich in Niedersachsen. Sie hat eine Fläche von gut 26 km² und 5820 Einwohner (Was natürlich täuscht, denn die meiste Zeit sind viel mehr Kurgäste an Bord!). |
Schnell verläßt er diesen Ort und begibt sich weiter fort. Wilhelm Busch | ||
 |  |  |
| Kaiser Karl, genannt »der Große«, wurde am 2. April 747 oder 748 geboren und starb am 28. Januar 814, also vor rd. 1.200 Jahren! Die Stadt Aachen hatte in 2014 zum runden Todestag drei Orte der Erinnerung an ihren großen Sohn eingerichtet: Schatzkammer im Dom, Ausstellung im Rathaus und Ausstellung im Museum Charlemagne. | Die Stadt ist eigentlich ein "Bundesland" und die fünftgrößte Stadt der Bundesrepublik. Sie ist sozusagen auch "Landeshauptstadt". Der Roland ist Mittelpunkt und ein Wahrzeichen der Stadt. Der Dom St. Petri und das Rathaus prägen das Zentrum, Roland und Rathaus gehören außerdem zum UNESCO-Welterbe. Ach - nicht zu vergessen: die Bremer Stadtmusikanten! | Als Jugendlicher erlebte ich den Start des Freilichtmuseum auf dem Kahlenbusch mit. |
.jpg) |  |  |
| " ... ist ein im gleichnamigen Ortsteil der Gemeinde Niederwiesa im Landkreis Mittelsachsen befindliches Barockschloss im Eigentum des Freistaates Sachsen. Umgeben ist das Schloss von einem Barockpark mit zahlreichen Wasserspielen, der 2005 zu einem der schönsten Parks Deutschlands gekürt wurde." | Johannes Rau, NRW-Politiker, langjähriger Ministerpräsident und später auch Bundespräsident, hat hier auf Spiekeroog in der Inselkirche geheiratet (in der neuen großen, denn die alte schöne war dafür zu klein, wie man liest), er hat hier seine Kinder taufen lassen und die Familie seiner Frau besitzt auf der Insel ein schönes Haus. | "Dort wo goldene Wasserfälle und riesige Gletscher, rauchende Vulkane und eruptive Geysire, mytische Nebel und blubbernde Schlammtöpfe sowie in wuchtigen Steinen beheimatete Elfen und schlichte Trolle die Reise bestimmen, hört das Land - um mit Halldór Laxness zu sprechen - auf irdisch zu sein, hat Anteil am Himmel! |
Reisen bedeutet herauszufinden, dass alle Unrecht haben mit dem, was sie über andere Länder denken. Aldous Huxley | ||
 |  |  |
| Das vor mehr als 2000 Jahren als »Augusta Treverorum« gegründete Trier gilt als älteste Stadt Deutschlands, da es Stadtrecht bereits in römischer Zeit besaß. Unter dem Namen »Treveris« erlangte es in der Spätantike, zur Zeit der Römischen Tetrarchie nach 293, seine größte Bedeutung. | Eine spannende und informative Reise durch das nördliche Spanien: Madrid - Avila - Salamanca ... bis Santiago de Compostela (das Ziel unzähliger Pilger, die sogar weiter bis "ans Ende der Welt" laufen!) und A Coruna, dann wieder über Léon zurück zur Hauptstadt. | Ich kannte den Namen Marokko, wusste, wo es liegt, aber bei der Hauptstadt gab es schon Unsicherheit. Welche Staatsform hat das Land? Wie verlief die Geschichte hier oben in Afrika? Was gibt es dort zu sehen? Es wurde Zeit, sich das einmal genauer anzusehen! |
 |  | 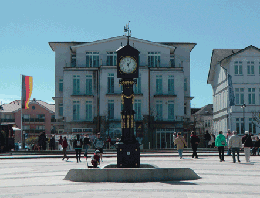 |
| "In der Regel kommen die sonnenhungrigen Besucher in Faro an und werden - wenn sie sich nicht einen Mietwagen nehmen - per Tranfer zu ihrem Hotel gefahren. | Der große Korse, Napoleon Bonaparte, wurde hier geboren. Die Insel - die zu Frankreich gehört - ist beliebt bei Wassersportlern und Wanderern. Und dann gab es für eine kurze Zeit auch noch einen König, der aus Westfalen stammte ... | "Nach der Wende kamen verschwundene Dinge wieder aus der Versenkung hervor: zum Beispiel die Kaiserbäder auf Usedom. Doch die Zeiten, in denen "Durchlaucht" die Sommerfrische an der Ostsee genoss, sind passé! |
Wo der Gletscher aufragt, hört das Land auf, irdisch zu sein, und die Erde hat Anteil am Himmel, dort wohnen keine Sorgen mehr, und deshalb ist die Freude nicht nötig, dort herrscht allein die Schönheit, über jede Forderung erhaben, der Wahrheit auf die Spur zu kommen. Halldór Laxness (über Island) | ||
 |  |  |
| Wir sind in Davos, in der Schweiz, an bedeutungsvollem Ort: Weltwirtschaftsgipfel! Und Thomas Mann hat hier seine Frau im Sanatorium auf der Alp besucht und sich zum "Zauberberg" inspirieren lassen. Und St. Moritz. Mit dem Bernina Express, der Rhätischen Bahn über und durch die Berge nach Andermatt - ein Erlebnis. Und wir fuhren am Rhein! Abstieg in die Viamala-Schlucht und in Luzern über die Brücke, und und ... | Vom Okzident zum Orient - in Istanbul trennt der Bosporus Europa von Asien. Die griechische Kolonie Byzantion wird 330 durch Kaiser Konstantin I. dem römischen Reich einverleibt und er macht nun Konstantinopel zur Hauptstadt des Römischen Reichs. Nach tausend Jahren waren die Belagerungen der Stadt durch die Osmanen erfolgreich und Syleymann der Prächtige wurde Herrscher von Istanbul, wie es nun hieß. | Kennen Sie das Riesengebirge? Wir fahren über Görlitz nach Karpacz zur Schneekoppe, über die "via sacra" zur Stabkirche und zum Kloster Grüssau, nach Hirschberg, Adersbach, Trautenau und Breslau, besuchen Carl und Gerhard Hauptmann sowie last but not least Rübezahl! |
 |  |  |
| Plau am See nennt sich auch »Stadt der vier Türme«! Na, viellicht etwas übertrieben, zumindest einseitig, denn Plau ist ein wirklich schöner kleiner Ort, der sich voll auf den Tourismus konzentriert. Und Plau hat mehr als Türme: Schifffahrt, Schleuse, Altstadt, Bimmelbahn und ein aktives Umfeld. | "Für den einen war es schon immer ein Traum, mal nach San Francisco zu kommen; der andere arbeitet im Medienberuf und interessiert sich für Hollywood-Studios, Silicon Valley und Las Vegas! Außerdem hat er den Auftrag, einmal zu Ghiradelli Eis essen zu gehen! Grund genug für Vater und Sohn, wieder einmal los zu fahren ..." | "Cottbus (niedersorbisch Chósebuz), ist eine kreisfreie Stadt im Land Brandenburg. Nach dessen Hauptstadt Potsdam ist sie die zweitgrößte Stadt und, neben Brandenburg an der Havel und Frankfurt (Oder), eines der vier Oberzentren des Landes. Obwohl in der Stadt selbst nur eine kleine Minderheit wohnt, gilt Cottbus als politisch-kulturelles Zentrum der Sorben in der Niederlausitz." aus Wikipedia |
Das Reisen führt uns zu uns selbst zurück. Albert Camus | ||